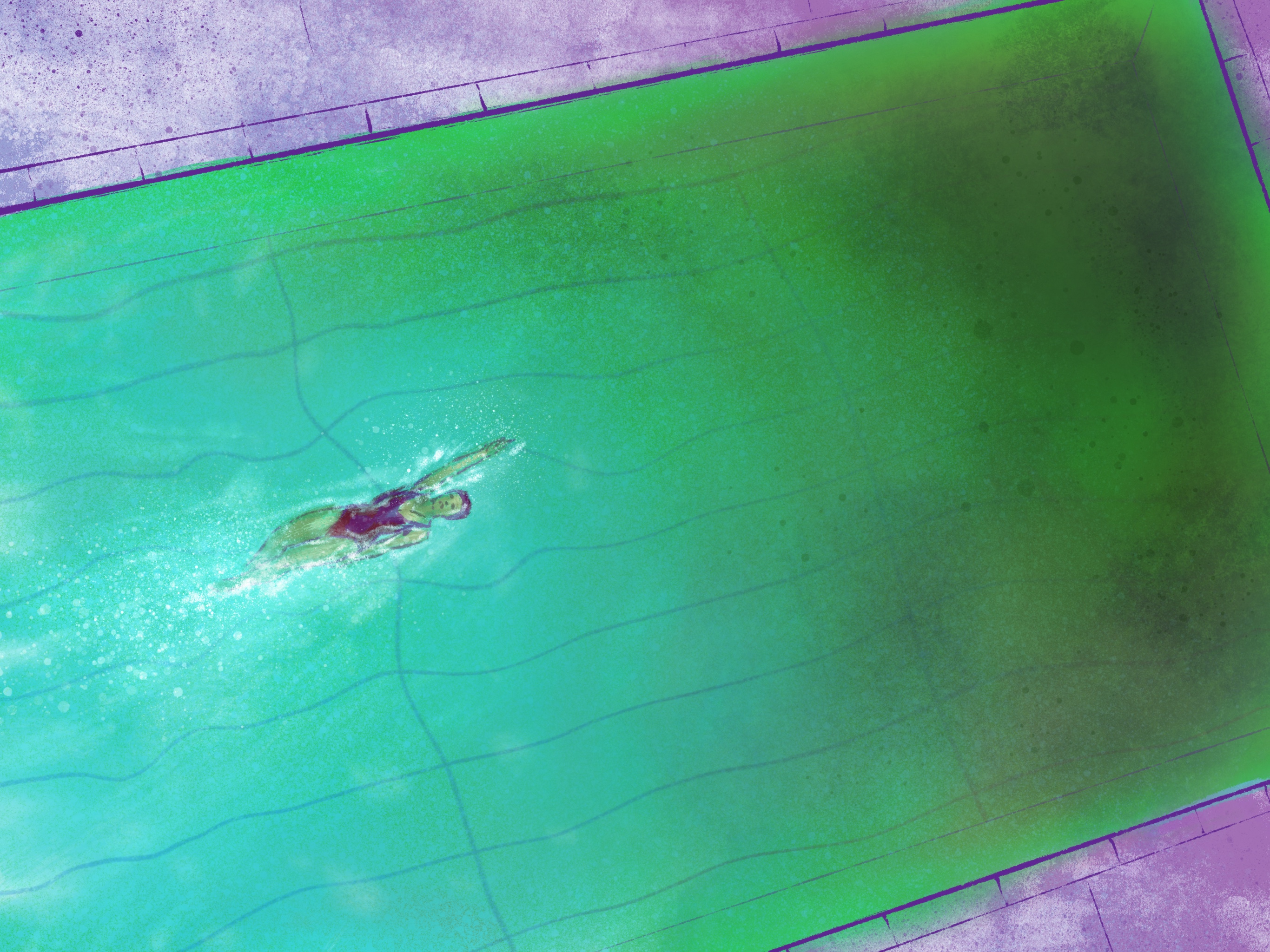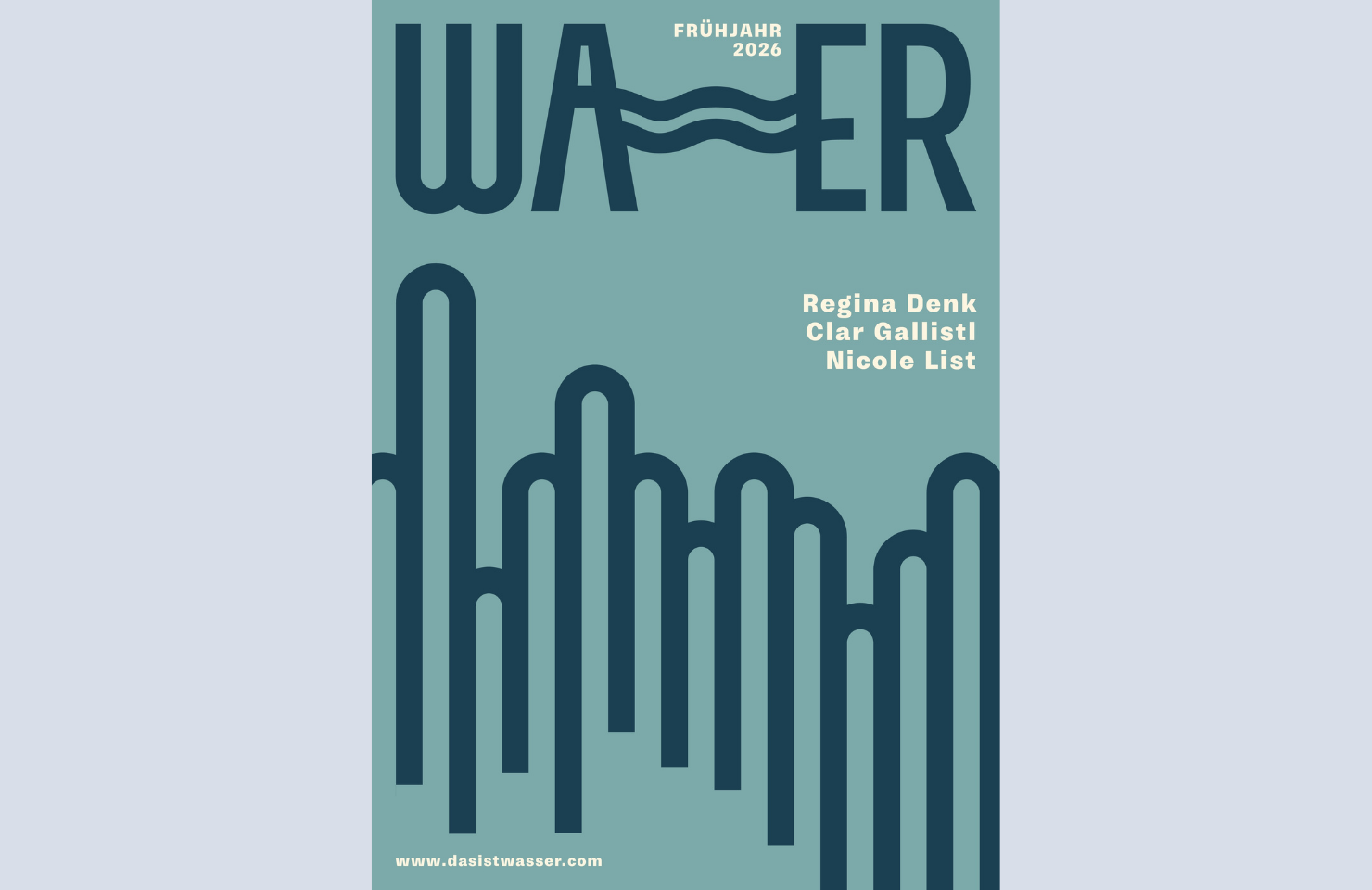Die Kraft der Unerschrockenheit
Ein Vorwort von Stefanie Jaksch
Nora Hamed steht auf der Launch-Feier von WASSER auf einmal vor mir. Sie kennt kaum jemanden, und ich denke sofort daran, wie unangenehm es mir ist, wenn ich allein auf Partys oder Veranstaltungen gehe. Nora aber steht da ganz selbstverständlich, und schon nach ein paar Sätzen ist klar: Sie liebt die Literatur. Sie liest, sie schreibt, sie will publizieren und vor allem: Sie hat einen eisernen Willen. Unter uns Programmleuten in Verlagen gibt es den Satz: Wir wissen schon nach ein paar Sekunden, wenn wir eine Person treffen und mit ihr arbeiten wollen. Enter Nora. Wir schreiben kurz darauf Mails hin und her, treffen uns, und ich bin fasziniert von ihrer Klarheit und ihrer Unerschrockenheit in Wort und Taten. Es dauert ein bisschen, bis wir den Dreh raus haben für Noras STRUDEL, und weil Texte nie in einem Vakuum entstehen, hilft im Hintergrund auch Maureen Reitinger mit. Als die Rohfassung von „Zwei Sterne, ein Himmel“ in meinem Postfach landet, weiß ich schon nach den ersten Sätzen: Das ist der Text, auf den wir hingearbeitet haben. Ein Text, der mir in Herz und Hirn fährt. Danke, Nora. Für deine Offenheit, deine Unnachgiebigkeit, für deine Geduld.
Nora Hamed schreibt auf Einladung von Maureen Reitinger.
Zwei Sterne, ein Himmel
Sie ist die Ältere, also wird von ihr erwartet, dass sie die Vernünftigere ist. Sie soll nett und liebevoll zu ihrem Bruder sein. Sie soll nicht zurückhauen, selbst wenn er grob wird. Sie soll teilen, selbst wenn er sie nervt. Sie soll ihm nicht die Zunge zeigen, selbst wenn er damit begonnen hat. Sie soll ihm das vollere Glas Kakao am Morgen überlassen. Es gibt unzählige „Soll“-Vorgaben. Von klein auf beginnt bei unseren Mädchen diese „Soll-Kultur“, die sie auf die „Muss-Kultur“ vorbereitet, die sie als erwachsene Frauen erwartet.
„Was soll ich noch alles? Was muss ich noch alles machen, um brav zu sein? Weißt du, Mama, ich muss nicht immer perfekt sein!“
Meine Tochter gab mir mit diesem Satz mein eigenes Mantra zurück, das ich ihr so oft versucht habe einzutrichtern, als ich es eigentlich selbst hören musste.
Liegt es wirklich nur am Altersunterschied meiner Kinder, oder spielen auch gesellschaftliche Erwartungen und eigene Erfahrungen doch eine größere Rolle, als mir lieb ist? Kann es sein, dass ich unbewusst bestimmte Verhaltensweisen aufgrund von Geschlechterstereotypen unterschiedlich bewerte?
Bin ich ehrlich zu mir selbst, wenn ich die Wut meines Sohnes auf die Trotzphase schiebe, oder ist Wut eine Eigenschaft, die wir Männern zuschreiben und die deshalb „aushaltbarer“ für mich ist?
Meinem Sohn sieht man den arabischen Migrationshintergrund nicht an, meiner Tochter schon. Sie ist für mich eine wahre Schönheit, eine arabische Prinzessin. Lange, dichte Wimpern, die ihre großen, dunklen Augen wie einen Kranz umranden. Volle, pigmentierte Lippen. Ihre Haut glänzt beinahe schon golden, wenn die Sonne sie küsst, ihr Haar ist dicht, lockig und wild. Sie ist die Art von Kind, bei dem die Omis in den Wiener Linien ganz entzückt sind von ihren großen, ausdrucksstarken Augen und der wilden Lockenpracht. Und sie wird die Art von Frau sein, die eines Tages von genau denselben Omis mit schiefem Blick angesehen werden und zu hören bekommen wird, sie soll sich doch bitte dorthin schleichen, woher sie kam.
Meinem Sohn wurde in diesem Leben das doppelte Privileg in die Wiege gelegt: Er hat helle Haut und Haare und: Er wird ein Mann! Der einzige sichtbare Rest meiner halbösterreichischen DNA, der meiner Tochter bleibt, ist die grünäugige, blonde Großmutter mit oberösterreichischem Dialekt. Sie war in meiner Kindheit schon mein weißes Privileg, das meine Tochter nun ebenso erben wird. Immerhin.
Vor ihrer Einschulung meinte meine Mutter zu mir: „Du, ich glaub, ich werde euch am Tag der Einschreibung begleiten, sonst stecken sie sie noch in die Ausländerklasse.“ Im ersten Moment war ich wütend. Wenn ich eine Sache noch weniger ausstehen kann als Rassismus, dann ist es latenter Rassismus. Doch ich wusste, dass sie recht hatte.
„Reicht mein perfektes Deutsch denn nicht aus, dass sie uns als bildungsnah einstufen?“
Meine Mutter begleitete uns.
Die weiße Mutter migrantisch gelesener Kinder wird zum Schutzschild. Als ob alleine ihre Präsenz als Garantie dient, dass diese Kinder nicht „fremd“ bleiben werden.
Meine Mutter hat mich vor vielen rassistischen Erfahrungen geschützt. Heute wird mir jedoch klar, dass dieser Schutz nichts anderes als ein stilles Integrationsversprechen an die weiße Mehrheitsgesellschaft war. Deshalb spreche ich in der Öffentlichkeit absichtlich oft in unserer Zweitsprache mit den Kindern. Sie sollen sich nicht dafür schämen. Ich bin niemandem ein Versprechen schuldig.
Wenn ich meiner Tochter Ehrgeiz, Stärke, Entscheidungsfreude, ein gutes Benehmen, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Geschicklichkeit und noch hunderttausend andere Eigenschaften abverlange, dann mit dem Hintergedanken, dass sie all dies brauchen wird, um später klarzukommen. Ich erkläre ihr die Bedeutung von Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit, möchte ihren Lebensrucksack mit allen Informationen füllen, um sie gut gewappnet in die Wildnis der Gesellschaft zu führen.
Meinem Sohn hingegen? Dem werden einige dieser Eigenschaften im Vornherein zugeschrieben werden, bevor er sich beweisen muss. Er wird den leichteren Weg haben. Sich nur halb so viel anstrengen müssen, um seinen Platz im System zu finden. Doppelt privilegiert. Bin ich deshalb nachgiebiger mit ihm und verlange ihm weniger ab?
Wenn es Zankereien gibt, erwarte ich von meiner Tochter, als der Älteren, dass sie genauso nachgiebig ist – und weil ich die Wut meines Sohnes schwerer ertrage als die meiner Tochter. Männliche Wut, die Angst macht? Oder doch der Welpenbonus? Ich werde es nie so genau wissen. Die Wut kommt trotzdem, nur eben von meiner Tochter. Einmal meinte sie zu mir:
„Ok Mama, dieses Mal muss ich nachgeben und warten. Aber das nächste Mal muss er warten. Er muss doch auch lernen, dass es nicht immer alles sofort geben kann.“
Ich atmete hörbar aus.
„Du hast recht. Auch er muss das lernen, aber vor allem muss ich das lernen. Danke!“
Meine siebenjährige Tochter hat mir klargemacht, dass sie den Lernprozess zwar verstand, aber nicht allein darin steckte – und damit hatte sie vollkommen recht.
Wir sind in der Phase angekommen, in der ich mich nicht mehr in Streitereien einmische. Ich habe mein Schiedsrichter-Trikot abgelegt. Anstatt personenorientiert, reagiere ich nun lösungsorientiert oder versuche es zumindest. Mittlerweile sagen meine Kinder:
„Mama, wir machen uns das untereinander aus und einigen uns, geh und lies ein Buch.“
Das nenne ich mal Erfolg, auch wenn mir klar ist, dass jeder Erfolg einer Erziehungsmaßnahme rein temporär ist und ich mich bereits auf bevorstehende Herausforderungen vorbereite. Auf manche Fragen kann man sich jedoch nicht vorbereiten.
„Wieso sind du und mein Bruder weiß und ich nicht, Mama?“
Ich schlucke kurz. „Weil dich die Sonne liebt und dir ihre Wärme gibt. Du bist wunderschön so.“
„Wenn ich groß bin, Mama, will ich genauso schön sein wie du!“
„Dafür musst du nicht groß werden. Du bist schon wunderschön und jede einzelne Schönheit wird in dieser Welt gebraucht, vor allem die da drinnen.“ Ich deute auf ihr Herz.
Sie lächelt mich an.
„Dann werde ich irgendwann vor lauter Schönheit platzen.“
Ich ziehe sie an mich und küsse ihre Stirn.
„Da hast du recht.“
Die Welt ist nicht gerecht. Und wir müssen uns damit abfinden, dass sie das nie zur Gänze sein wird. Doch anstatt unsere Töchter darauf vorzubereiten, in einer patriarchalen Gesellschaft zurechtzukommen, sollten wir unsere Söhne dazu erziehen, veraltete Strukturen aktiv zu verändern.
Ich habe aufgehört, meine Tochter als potenzielles Opfer in diesem System zu sehen. Stattdessen konzentriere ich mich darauf, meinen Sohn zu einem bewussten Mitgestalter zu erziehen. Zu einem Mann, der Verantwortung übernimmt und für Gerechtigkeit eintritt. Und ich weiß für mich, dass Gleichbehandlung nicht bedeutet, alles identisch zu machen. Sondern die Einzigartigkeit meiner Tochter und meines Sohnes zu sehen und ihnen das zu geben, was er oder sie braucht. Aber wie meine Tochter schon meinte: „Es muss niemand perfekt sein.“